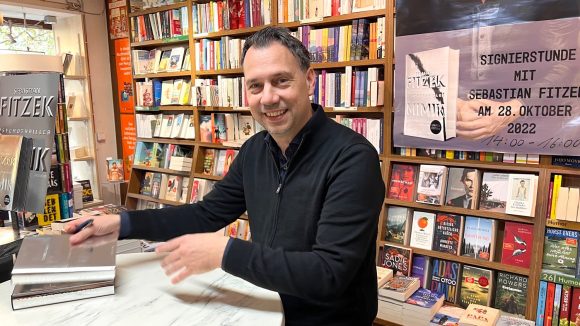Neuer Stolperstein in Dahlem für Hildegard Rosenthal

Stolpersteine – sie sind inzwischen in über zwanzig europäischen Ländern zu finden. Die quadratischen Steine mit der aufgesetzten Messingplatte werden stets vor der letzten Wohnstätte von Menschen in den Bürgersteig eingelassen, die während der Nazizeit unter den Machenschaften des Nationalsozialismus leiden mussten. Sie wurden denunziert, vertrieben, deportiert, weggesperrt und umgebracht.
Die Stolpersteine regen zum „Stolpern“ an. Ganz unvermittelt entdeckt man sie hier und dort im Straßenbild. Sie zeigen auf, dass genau an dieser Stelle vor vielen Jahren ein Mensch mitten unter uns gelebt hat, der plötzlich und brutal ausgegrenzt, verfolgt, misshandelt und oft genug auch ums Leben gebracht wurde.
Die Idee zu den Stolpersteinen kommt vom Künstler Gunter Demnig, der seit 1993 Spenden sammelt und in der ganzen Nation unterwegs ist, um neue Stolpersteine (www.stolpersteine.eu) ins Trottoir zu setzen. Weit über tausend Steine sind auf diese Weise bereits realisiert worden. Ihre eingeprägte Aufschrift zeigt auf einen Blick, wer an dieser Stelle einmal gewohnt hat und was mit diesem Menschen zwischen 1933 und 45 passiert ist.
80 Jahre nach den Novemberpogromen 1938 keimt zunehmend wieder fremdenfeindliches Gedankengut auf. Am 9. November hat das Martin-Niemöller-Haus Berlin-Dahlem zusammen mit den evangelischen Kirchenkreisen Steglitz und Teltow-Zehlendorf ein Zeichen gegen öffentliche Anfeindungen und Ausgrenzungen setzen wollen – und in Kooperation mit dem Projekt-Stolpersteine (www.projekt-stolpersteine.de) einen neuen Stolperstein in der Straße „Im Dol“ verlegt – für die Jüdin Hildegard Rosenthal, die sehr wahrscheinlich in Auschwitz umgebracht wurde.





Am 20. Mai 1896 wird Bertha Mathilde Hildegard Laubhardt in Berlin geboren. Ihr Vater ist Amtsgerichtsrat. Drei Geschwister hat Hildegard, ihre Kindheit verbringt sie in Berlin. Sie wird evangelisch getauft. Um 1909 wird der Vater nach Bunzlau in Schlesien versetzt, die Familie zieht mit. 1916 schließt Hildegard die Schule mit dem Abitur ab, sie besucht anschließend das Lehrerseminar. 1928 konvertiert die junge Frau zum Judentum. Zusammen mit ihrer Schwester Ilse geht sie nach Palästina, wo sie als Lehrerin arbeitet. Heimweh und ein abgelaufener Pass führen dazu, dass Hildegard 1936 nach Deutschland zurückkehrt. In Berlin-Dahlem arbeitet sie an der jüdischen Schule von Lotte Kaliski und unterrichtet Hauswirtschaft. In dieser Zeit lernt sie ihren späteren Mann kennen – Friedrich Rosenthal.
Die Schule in Dahlem wird geschlossen. Im März 1939 unterrichtet Hildegard an einer Grundschule der jüdischen Gemeinde im Prenzlauer Berg. In dieser Zeit sind die Rosenthals bereits von der Deportation bedroht. Im Juli 1942 werden die Eltern von Friedrich Rosenthal deportiert. Das Ehepaar beschließt, zu flüchten.
Am 11. Dezember 42 verlässt es die gemeinsame Wohnung in Dahlem und taucht mit gefälschten Papieren unter. 1943 spürt die Gestapo die Rosenthals in Saarbrücken auf, am 12. April kommt es zur Festnahme. Friedrich Rosenthal kann das Zyankali, das das Paar für diese Notsituation mit sich führte, noch schlucken, Hildegard wird es aus der Hand geschlagen. Sie wird nach Berlin gebracht und verhört. Am 29. Juni 1943 wird Hildegard Rosenthal nach Theresienstadt deportiert. Ihr früherer Religionslehrer Leo Baeck, der ebenfalls vor Ort inhaftiert ist, berichtet, dass Hildegard dort gegen das geltende Verbot Kinder unterrichtet haben soll. Am 12. Oktober 1944 wird sie nach Auschwitz deportiert und dort vermutlich sofort ermordet.
Diese Biografie wäre in Vergessenheit geraten, hätte nicht eine 11. Klasse der Gail-S.-Halvorsen-Schule sie in mühevoller Arbeit im Rahmen des Politik-Geschichts-Kurses recherchiert, zusammengetragen und ausformuliert. Der Text wurde am 9. November passend zum 80. Jahrestag der Pogromnacht anlässlich einer Stolperstein-Verlegung für Hildegard Rosenthal vorgelesen. Die Biografie wird seitdem im nahen Martin-Niemöller-Haus Berlin-Dahlem verwahrt.



In der Dahlemer Straße „Im Dol“ weist nun ein Stolperstein im Bürgersteig auf den letzten freiwilligen Wohnort der Hildegard Rosenthal hin. Michael Rohrmann vom Projekt-Stolpersteine der evangelischen Kirchenkreise Steglitz und Teltow-Zehlendorf setzte den vorbereiteten Stein ins Trottoir. Zur Zeremonie sprachen auch die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf Cerstin Richter-Kotowski, die Superintendenten Johannes Krug und Thomas Seibt vom Kirchenkreis und der Rabbiner Andreas Nachama. Ben Barkow, ein Großneffe Hildgard Rosenthals und heute Direktor der Wiener Library in London, war ebenso vor Ort wie die stellvertretende US-Botschafterin Robin Quinville.
Rabbiner Andreas Nachama: „Wir gedenken Hildegard Rosenthal und der sechs Millionen Männer, Frauen und Kinder, die ermordet wurden, nur weil sie Juden waren.“
Bürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski: „Manchmal sind Zahlen zu abstrakt, um sie begreifen zu können. Hinter jeder einzelnen Zahl steht eine eigene Lebensgeschichte. Die Stolpersteine sind klein und unscheinbar, aber sie halten die Erinnerung wach. Sie geben Menschen wieder ein Gesicht. Nur der, der vergessen wird, ist wirklich tot.“
Michael Rohrmann vom Projekt-Stolpersteine: „Eine Gruppe aus Dahlem hat vier Jahre lang recherchiert und Fakten gesammelt und Kontakt zu Angehörigen gesucht. Bislang gibt es es 550 Stolpersteine in Steglitz-Zehlendorf. Ein einzelner Stein kostet 120 Euro. Unser Projekt-Stolpersteine wurde 2005 gestartet – zunächst als Jugendprojekt der Kirche.“
Die Stolperstein-Verlegung am 9. November wurde sehr gut besucht. Eine dichte Menschentraube nahm an der Zeremonie teil und zeigte damit ein großes Interesse daran, dass die Sünden der Nazizeit nicht in Vergessenheit geraten. Auch die jungen Leute zeigten Präsenz: So hatte Religionslehrer Jan Mävers seine ganze 7. Klasse vom Gymnasium Steglitz mitgebracht.
Für die Gail-S.-Halvorsen-Schule ist das eigene Engagement mit der Erarbeitung der Biografie der Hildegard Rosenthal noch längst nicht ausgereizt. Schulleiterin Kathrin Röschel: „Wir kümmern uns bereits um die Pflege von vier Stolpersteinen an unserer Schule. Wir werden auch die Patenschaft für den Stolperstein von Hildegard Rosenthal übernehmen und uns um die regelmäßige Reinigung des Steins kümmern.“



Der Kirchenkreis hatte übrigens passend zum 9. November dazu aufgefordert, der „Aktion Glanz“ zu folgen und dabei zu helfen, die im Bezirk gesetzten Stolpersteine zu putzen. So griffen in der Spanischen Allee Mitarbeiter des Evangelischen Krankenhauses Hubertus zu Zahnbürste und Schwamm, um fünf Stolpersteine vor der Hausnummer 10 zu ihrem alten Glanz zu verhelfen. Geschäftsführer Dr. med. Matthias Albrecht: „Zwar wohnten die Menschen hier, bevor unser Krankenhaus errichtet wurde. Dennoch ist es wichtig, dass ihr Schicksal nicht in Vergessenheit gerät. Gerade heute ist es wichtiger denn je, mit solchen Gedenkaktionen auch die Botschaft zu senden: Wir distanzieren uns von der gesellschaftlich erneut aufflackernden antisemitischen Hetze und Fremdenfeindlichkeit jedweder Art.“ (Text/Fotos: CS)
Dieser Artikel wurde in „ZEHLENDORF.aktuell“ Ausgabe 57 (12/2018) veröffentlicht.
Seitenabrufe seit 22.02.2019:
Sie haben eine Artikelidee oder würden gern eine Anzeige buchen? Melden Sie sich unter 03322-5008-0 oder schreiben eine Mail an info@zehlendorfaktuell.de.
Anzeige